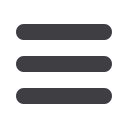
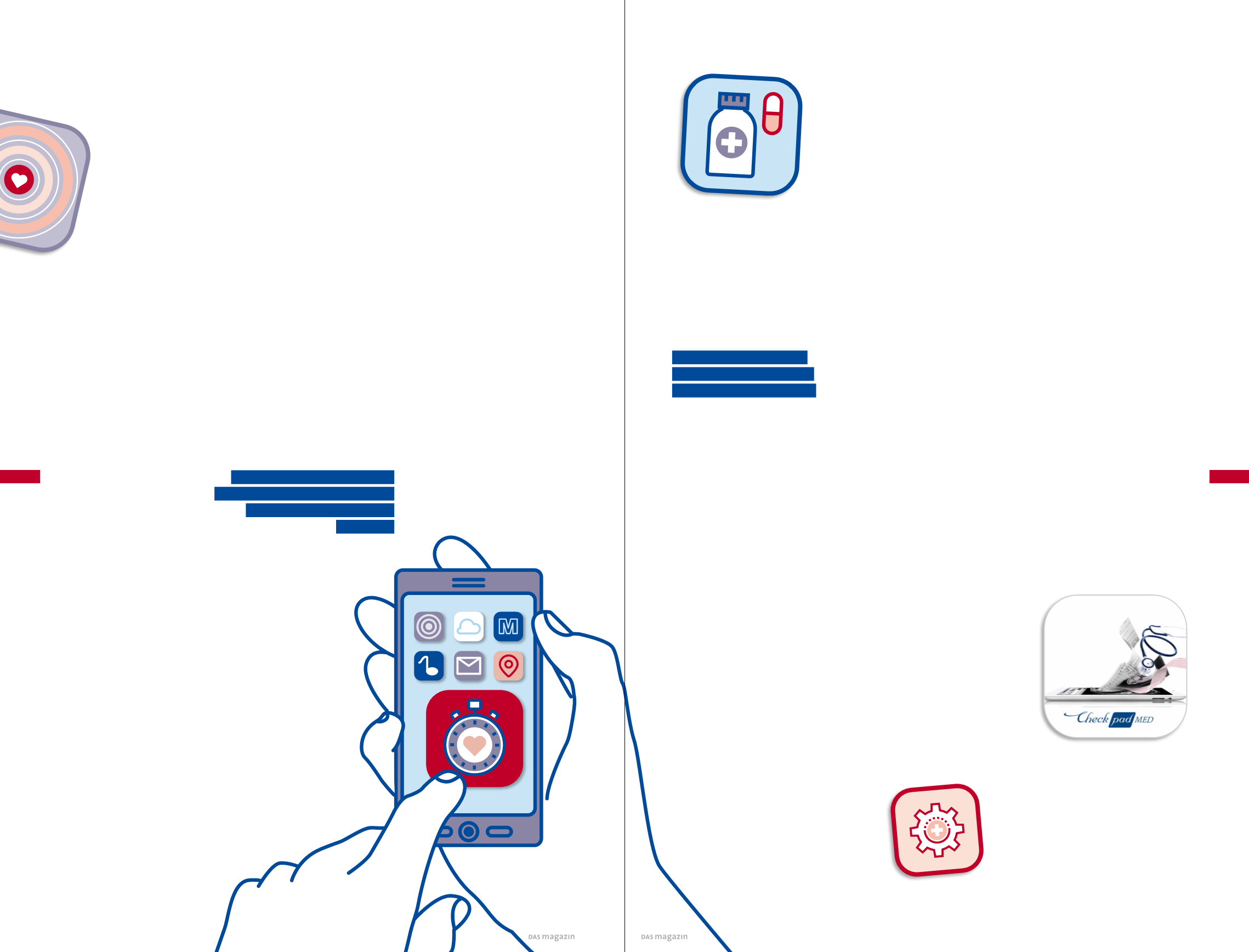
Schritte zählen und den Puls messen
können sie schon lange: Jetzt werden
Smartphones fit gemacht für den pro-
fessionellen Einsatz im Gesundheits-
wesen. Das Universitätsklinikum Frei-
burg gehört dabei bundesweit zu den
Vorreitern
Das Smartphone ist für viele
Menschen längst ein alltäglicher
Begleiter. Aber erst mit kleinen Zu-
satz-Programmen, Apps genannt,
lassen sich die Möglichkeiten der Ho-
sentaschen-Computer so richtig
ausnutzen. Mehr als 100.000 Fit-
ness- und Gesundheits-Apps und
allein 40.000 Apps zu medizini-
schen Themen werden im Internet
angeboten.
Mittlerweile erinnern Apps
an fällige Impftermine, messen per
Kamera den Blutzuckerspiegel oder
bestimmen die aktuelle Symptom-
stärke bei einem Parkinson-Patien-
ten. „Gesundheits-Apps tragen im
besten Fall dazu bei, dass Patienten
zu Experten ihrer eigenen Krankheit
werden“, sagt Dr. Martin Lucht, Ko-
ordinator am Studienzentrum des
Universitätsklinikums Freiburg.
Zukünftig sollen die Patienten Ge-
sundheitsdaten direkt per App an
den behandelnden Arzt senden oder
mit ihm in Kontakt treten können.
Der Arzt wiederum könnte von sich
aus Patienten kontaktieren, wenn er
eine deutliche Verschlechterung der
Werte beobachtet.
Doch wer eine Gesundheits-App
nutzen möchten, sollte sich einige
Fragen stellen: Ist die App für mich
geeignet? Was geschieht mit mei-
nen Daten? Wie zuverlässig sind die
Ergebnisse und Empfehlungen? Wer
steckt hinter dem Angebot? Anfang
2016 ist das E-Health-Gesetz in Kraft
getreten. Seither müssen zwar be-
stimmte Apps als Medizinprodukt
zertifiziert werden, aber oft bleibt
unklar, für welche Programme das
gilt und ob sich der Hersteller darum
kümmert. Noch schwieriger ist die
Frage zu beantworten, welchen Zu-
satznutzen eine App hat. „Nur wenn
die Einführung der Apps von einer
entsprechenden Studie beglei-
tet wird, lässt sich sagen,
ob Ärzte oder Patienten
auch wirklich davon
profitieren“, sagt der
Versorgungsforscher
Professor Dr. Werner
Vach vom Institut für
Medizinische Biometrie
und Statistik des Univer-
sitätsklinikums Freiburg.
Hier könnten renom-
mierte
Institutionen
wie die Universitäts-
kliniken in Zukunft als
eine Art Qualitätssiegel
fungieren. Sie kennen die
Bedürfnisse der Patienten,
bieten Ressourcen zur Ent-
wicklung innovati-
ver Apps und
haben
viel Erfahrung bei der Durchfüh-
rung von Studien. „Wenn der Patient
weiß, dass eine zuverlässige Institu-
tion die App entwickelt und geprüft
hat, kann er davon ausgehen, dass
dabei sauber gearbeitet wurde“, sagt
der Informatiker Dr. Martin Boeker,
der den Bereich für Medizinische
Informatik des Instituts für Medizi-
nische Biometrie und Statistik des
Universitätsklinikums Freiburg lei-
tet.
Auch für Ärzte und Forscher kön-
nen Apps sehr wertvoll sein, etwa
als digitale Nachschlagewerke mit
Hintergrundtexten, Bildern, Videos
und weiteren
Zusatzfunktionen zu einem spezi-
ellen Thema. Außerdem helfen die
kleinen Programme bei einem gro-
ßen Problem der modernen Medizin:
Welche Therapie für welche Pati-
enten am besten ist, untersuchen
Forscher in Studien. Dafür müssen
Patienten häufig einen Fragebogen
ausfüllen und an den Arzt zurück-
senden. Wird der Fragebogen falsch
oder verspätet ausgefüllt oder geht
er gar verloren, fehlen wichtige
Studiendaten. Hier können Apps
helfen. Die Programme übermitteln
die Daten sofort und die Befragung
kann nach einem festgelegten Plan
oder spontan erfolgen. „Studien mit
Unterstützung von Apps durchzu-
führen, kann sehr sinnvoll sein. So
können wir deutlich mehr Patienten
erreichen als bisher“, sagt Studi-
enkoordinator Lucht.
Die Frage, was Gesundheits-Apps
können sollen, muss die Gesellschaft
wohl immer wieder aufs Neue dis-
kutieren: Dürfen sie lebensgefähr-
liche Krankheiten diagnostizieren,
medikamentöse Empfehlungen oder
im Notfall wie ein Arzt sogar Hand-
lungsanweisungen geben? Entschei-
dend wird in jedem Fall sein, dass
Apps die Verbindung zwischen Arzt
und Patienten stärken und nicht
schwächen.
APP IN DI E
MEDIZIN-ZUKUNFT
Apps sollen die Verbindung
zwischen Arzt und Patienten
stärken und nicht schwächen
Die Frage, was Gesundheits-Apps
können sollen, muss die Gesellschaft
wohl immer wieder aufs Neue
diskutieren
Mit der digitalen Patientenakte
Checkpad MED für mobile Endgeräte
(z.B. iPad Mini, iPod Touch) können
Ärzte strukturiert und effizient ar-
beiten. Das Programm ermöglicht
jederzeit und mobil den Zugriff
auf die Krankengeschichte, Arzt-
briefe, Laborwerte, Röntgenbilder,
OP-Berichte und vieles mehr. Diese
Informationen und Bilder werden
auf die Endgeräte übertragen und
sind während der gesamten statio-
nären Behandlung verfügbar. Zu-
dem können Aufgaben erstellt, vom
Ärzteteam eingesehen und der Be-
arbeitungsstatus verfolgt werden.
So ist das gesamte Team immer auf
dem aktuellen Stand. Das spart Zeit
und vereinfacht die Kommunika-
tion zwischen den Ärzten und mit
den Patienten. An der Entwicklung
von CheckpadMed waren Ärzte um
Professor Dr. Norbert Südkamp,
Ärztlicher Direktor der Klinik für
Orthopädie und Unfallchirurgie des
Universitätsklinikums Freiburg, be-
teiligt.
DIGITALE PATI ENTENAKTE FÜR MOBI LE ENDGERÄTE
40.000
Apps zu medizinischen Themen
gibt es aktuell
35
02 | 2016
02 | 2016
34



















