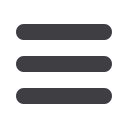
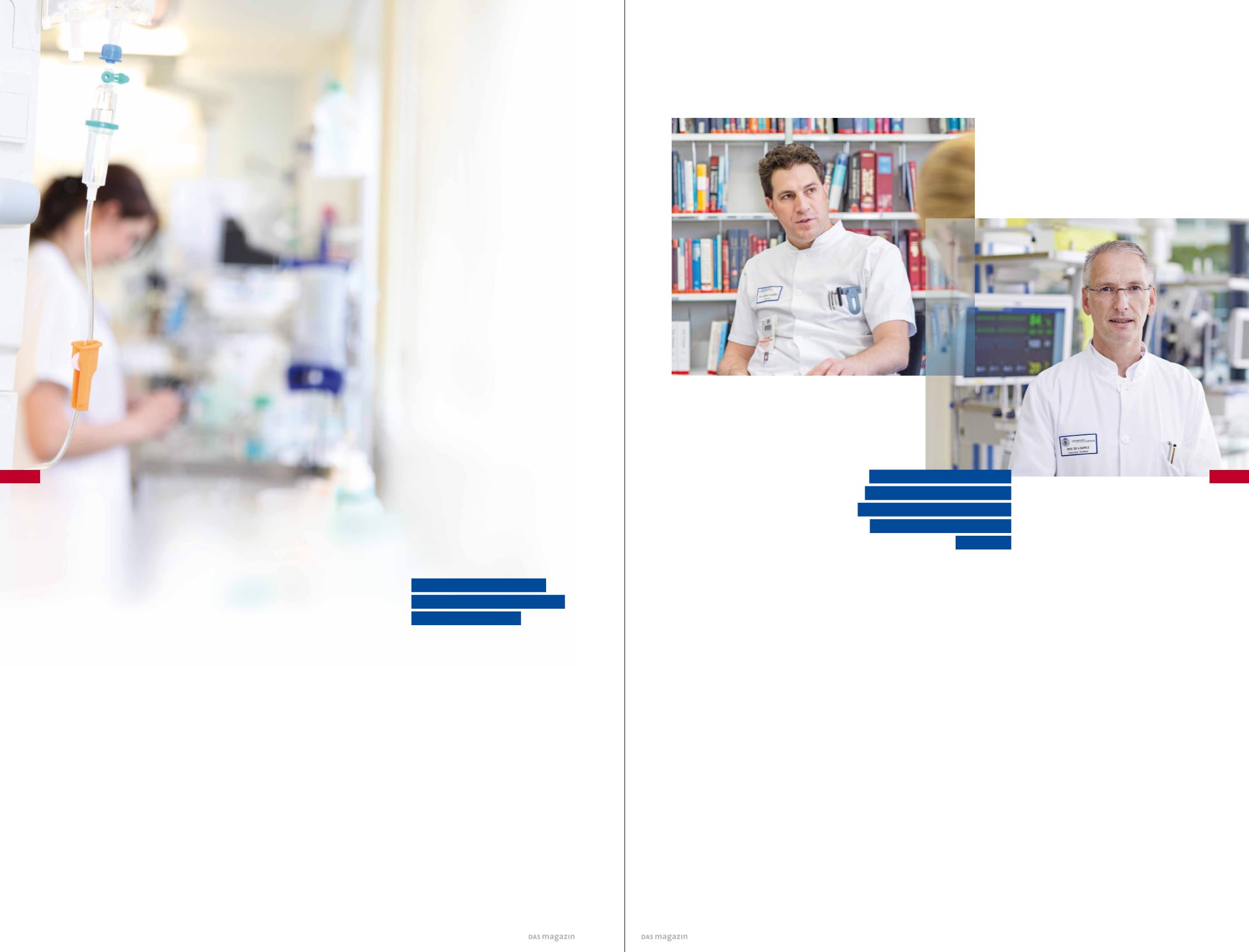
Beatmungsschlauch, Blasenkatheter,
intravenöse Zugänge: Niemand liegt
gern auf einer Intensivstation. Wenn
es doch dazu kommt, scheinen starke
Beruhigungsmittel den Aufenthalt
erträglicher zu machen. Professor
Dr. Hartmut Bürkle, Ärztlicher Direk-
tor der Klinik für Anästhesiologie und
Intensivmedizin am Universitätskli-
nikum Freiburg, und Oberarzt Dr.
Johannes Kalbhenn erklären, warum
sie ihre Intensivpatienten trotzdemam
liebsten bei vollem Bewusstsein halten
Herr Professor Bürkle, warum sollte ich
als Patient den Aufenthalt auf Ihrer In-
tensivstation bewusst erleben wollen?
Bürkle
Je wacher Sie sind, des-
to kürzer liegen Sie in aller Regel
bei uns. Sie müssen weniger lange
beatmet werden, haben weniger
Druckgeschwüre und Ihr Risiko für
schwere Komplikationen wie Lun-
genentzündungen sinkt.
Trotzdem gilt es viel Unangenehmes
auszuhalten. Ist das nicht sehr belas-
tend?
Kalbhenn
Sicher. Doch eine dau-
erhafte Sedierung mit starken Be-
ruhigungsmitteln ist nicht weniger
belastend. Auch ein sedierter Pati-
ent wacht fast vollständig auf, wenn
er Durst leidet, Schmerzen hat oder
Angst empfindet. Nur kann er diese
Bedürfnisse nicht äußern. Viele se-
dierte Intensivpatienten erinnern
sich an solche Momente, und ein
Drittel von ihnen hat später mit ei-
ner Posttraumatischen Belastungs-
störung (PTBS) zu kämpfen.
Und wache Patienten sind weniger
belastet?
Bürkle
Sedierungsfreie Patienten
haben den Vorteil, dass sie ihreWün-
sche äußern und wir ihnen helfen
können. Wer Schmerzen hat, erhält
exakt angepasste Schmerzmittel,
wer Angst hat, kann mit Therapeu-
ten oder Seelsorgern sprechen und
angstlösende Medikamente bekom-
men. Bislang sind bei wachen Inten-
sivpatienten keine Fälle von PTBS
bekannt.
Kalbhenn
Außerdem können wa-
che Patienten aktiv zu ihrer Gene-
sung beitragen. Selbst wenn sie am
Beatmungsschlauch hängen oder
kreislaufunterstützende Medika-
mente benötigen, können sie mit
früher Mobilisierung und Physio-
therapie ihre Lungen- und Kreislauf-
funktion stärken.
Seit Anfang 2013 verzichten Sie weit-
gehend auf Sedativa und leisten damit
deutschlandweit Pionierarbeit. Wie
schwierig war die Umstellung?
Kalbhenn
Die Abläufe auf der In-
tensivstation haben sich komplett
verändert. Am Anfang stand oft die
Befürchtung, dass wache Patien-
ten mehr Arbeit bedeuten. Das ist
nicht unbedingt der Fall, im Gegen-
teil: Ein wacher Patient kann häufig
sein Durstgefühl selbst stillen, eine
Schmerzmittel-Pumpe bedienen,
sich anders hinlegen, zu- oder aufde-
cken. Allerdings werden die Arbeits-
abläufe weniger planbar. Und von
dieser Veränderung sind vor allem
die Pflegekräfte betroffen. Ein sol-
ches Konzept ist also nur als Team-
leistung möglich.
Bürkle
Wir betreiben einen hohen
Aufwand, um den Bedürfnissen un-
serer Patienten gerecht zu werden.
Massage, aktive Physiotherapie mit
Bettfahrrädern und Rüttelbrettern,
Ergotherapie sowie psychologische
Betreuung und geistlicher Beistand
helfen bei der Genesung.
Was hat sich durch die Umstellung für
Sie persönlich geändert?
Bürkle
Die Beziehungen zu den
Patienten sind viel intensiver. Ei-
nes der eindrucksvollsten Beispiele
für uns alle war eine Patientin mit
Lungenversagen. Obwohl ihr Leben
von einer Maschine abhing, die ihr
Blut außerhalb des Körpers mit Sau-
erstoff anreicherte, feierte sie ihren
Geburtstag mit ihrer Tochter auf
unserer Station. Später bedankte sie
sich für das hohe Maß an Autonomie,
das sie in dieser extremen Situation
erleben konnte.
Und wo liegen die Grenzen der wachen
Intensivstation?
Kalbhenn
Ganz klar bei Krank-
heitsbildern, die nur unter Sedierung
behandelt werden können, wie beim
Schädel-Hirn-Trauma. Aber sedie-
rungsarme Intensivstation heißt ja
nicht, dass alle ein bisschen sediert
sind, sondern je nach Bedarf die
meisten gar nicht und manche eben
auch voll.
Herr Professor Bürkle, Sie haben an der
Leitlinie der Fachgesellschaft für deut-
sche Anästhesie und Intensivmedizin
mitgearbeitet, die weniger Sedierung
in der Intensivmedizin empfiehlt. Was
motiviert Sie zu diesem Engagement?
Bürkle
Bei der Arbeit an den Leit-
linien haben wir Daten aus zahl-
reichen Studien ausgewertet und
konnten weitverbreitete Irrtümer
widerlegen. So ist der Schlaf sedier-
ter Patienten weniger erholsam als
gedacht, die Medikamente verhin-
dern sogar normale Schlafphasen.
Auch leiden besonders ältere Pati-
enten nach tiefer Sedierung häu-
figer und schwerer unter geistiger
Verwirrtheit, dem sogenannten De-
lir. Sedativa können diese Störung
der Hirnfunktion nicht mildern, sie
kaschieren sie nur. Ohne Sedierung
wird das Delir sichtbar – und damit
behandelbar. Je mehr Patienten wir
wach begleiten können, desto mehr
Wissen sammeln wir über die opti-
male Versorgung schwerstkranker
Patienten.
„Sedierungsfreie Patienten
können ihre Wünsche äußern –
und wir ihnen helfen“
WACHE INTENSIVSTATION
BE I VOLLEM
BEWUSSTSE IN
„Je mehr Patienten wir wach
begleiten, desto mehr Wissen
sammeln wir über die optimale
Versorgung schwerstkranker
Patienten“
5
02 | 2016
02 | 2016
4



















