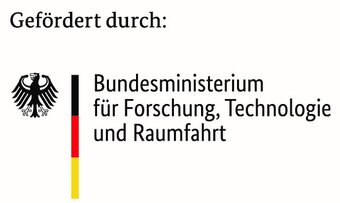Newsletter: Qualy GAIN – erste Ergebnisse
Ziel des Forschungsprojekts Qualy-GAIN ist die Verbesserung der Versorgung und Lebensqualität von Patient*innen mit Multi-Organ-Autoimmunerkrankungen. Insgesamt haben knapp 180 Patient*innen mit Multi-Organ-Autoimmunerkrankungen an den Befragungen unserer Längsschnittstudie teilgenommen. Wir haben uns über diese großartige Teilnehmerzahl sehr gefreut!
Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Gesamtgruppe aller Studienteilnehmenden der Längsschnittstudie. Ihre individuellen Ergebnisse wurden Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin zurückgemeldet, wenn Sie Ihr Einverständnis dazu erteilt haben.
Ergebnisse zur Lebensqualität
Im Projekt Qualy-GAIN wurde ein Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und des Gesundheitszustands von Patient*innen mit Multi-Organ-Autoimmunerkrankungen aus etablierten Fragebögen zusammengestellt, der je nach betroffenen Organen andere Fragen enthält. So kann in der Praxis individuell die Lebensqualität erfasst werden. Unsere Analysen haben ergeben, dass der Fragebogen die selbstberichtete Lebensqualität und den Gesundheitszustand zuverlässig und genau erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass der entwickelte Fragebogen ein gut anwendbares und zuverlässiges Instrument zur individuellen Erfassung der Lebensqualität und des Gesundheitszustands von Patient*innen mit Multi-Organ-Autoimmunerkrankungen darstellt.
Die gesundheitsbezogene Lebensqualität der teilnehmenden Patient*innen ist – wie zu erwarten war – sehr unterschiedlich und liegt im Durchschnitt unterhalb einer gesunden Vergleichsgruppe. Bei etwa 70 % der befragten Patient*innen mit Autoimmunerkrankungen liegt eine Fatigue vor. Die insgesamt niedrigere Lebensqualität im Vergleich zu gesunden Personen sowie die hohe Fatigue-Belastung bei einem Großteil der Patient*innen verdeutlichen den umfassenden Einfluss dieser Erkrankungen auf das tägliche Leben.
Außerdem wurde der Zusammenhang der Angaben zur Lebensqualität im Fragebogen mit den im GAIN-Register hinterlegten Blutwerten überprüft. Hier zeigte sich, dass es bedeutsame Zusammenhänge zwischen der selbstberichteten Lebensqualität und dem Gesundheitszustand der Patient*innen mit den Entzündungswerten gibt (CRP). Beim Hämoglobin ließ sich ein Zusammenhang mit der Lebensqualität von Patient*innen mit Lungenerkrankungen feststellen. Bei den anderen untersuchten Blutwerten (z.B. IgG, Ferritin, sIL2, Kalium) konnten wir keine Zusammenhänge mit der Lebensqualität oder dem Gesundheitszustand feststellen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Blutwerte – insbesondere CRP und Hämoglobin – mit der selbst eingeschätzten Lebensqualität und dem Gesundheitszustand der Patient*innen zusammenhängen. Dies legt nahe, dass Entzündungsprozesse und der Sauerstofftransport im Körper eine Rolle für das subjektive Wohlbefinden für Patient*innen spielen.
Ergebnisse zu den Präferenzen in der Behandlung
Ein weiteres Ziel des Projekts bestand darin, einen Fragebogen zu entwickeln, der die wichtigsten Behandlungspräferenzen von Patient*innen erfasst. Die Kenntnis dieser Präferenzen soll es Ärztinnen und Ärzte ermöglichen, die Behandlung an den individuellen Präferenzen der Patient*innen auszurichten. Eine Grundannahme, die im Rahmen des Projektes geprüft wurde, besteht darin, dass sich eine Ausrichtung der Behandlung an den Präferenzen der Betroffenen positiv auf deren Gesundheit und gesundheitsbezogene Lebensqualität auswirkt.
Bei der Entwicklung des Fragebogens zur Erfassung der Behandlungspräferenzen war es uns ein Anliegen, die Einschätzungen, Sichtweisen und Wünsche von Patient*innen im Prozess der Fragebogenentwicklung immer wieder einzubeziehen. Aus diesem Grund haben wir zunächst Telefoninterviews mit Patient*innen zu ihren Behandlungspräferenzen geführt und zu den geäußerten Präferenzen Fragen für den Fragebogen formuliert. Die Relevanz dieser Fragen wurden in einer anschließenden Delphi-Studie von weiteren Betroffenen beurteilt. Für eine Auswahl der relevantesten Fragen wurden schließlich Telefoninterviews mit Patient*innen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Fragen eindeutig und gut verständlich sind. Die auf diese Weise ausgewählten und sprachlich überarbeiteten Fragen bildeten den Fragebogen, der in der Längsschnittstudie eingesetzt wurde. Die Analyse der Antworten der etwa 180 Patient*innen, die an der Längsschnittstudie teilgenommen haben, ergaben, dass die Fragen zur Erfassung der Präferenzen der Patient*innen, auf drei Themenbereiche abzielen:
- Die Informierung durch den Behandelnden (z.B. über den Stand, die Entwicklung und neue Erkenntnisse zur Erkrankung der Patient*innen) und das gemeinsame Entscheiden im Rahmen des Behandlungsprozesses (z.B. das Abwägen von Vor- und Nachteilen verschiedener Behandlungsmöglichkeiten).
- Die Empathie des Behandelnden im Rahmen der Behandlungsgespräche. Dies umfasst Aspekte wie genaues Zuhören des Behandelnden, sich in die Situation der Patient*innen hineinversetzen können und auf Ängste und Sorgen der Patient*innen eingehen.
- Die Organisation der Behandlung. Hierunter fielen beispielsweise Fragen zur Erreichbarkeit des Arztes bzw. der Ärztin bei Fragen und in Notfällen, der zeitnahe Erhalt von Untersuchungsergebnissen und die Zusammenarbeit und Informationsweitergabe zwischen den Ärzte und Ärzt*innen, die in die Behandlung der Patient*innen eingebunden sind.
Die Analysen der Längsschnittstudie ergaben zudem, dass die Präferenzen der Patient*innen zu diesen drei Themenbereichen mit den insgesamt 18 Fragen des Fragebogens effizient, zuverlässig und valide erfasst werden können. In der Längsschnittstudie, die vier Befragungen im Abstand von jeweils 3 Monaten umfasste, zeigte sich zudem, dass Patient*innen, deren Präferenzen zu einem früheren Befragungszeitpunkt in größerem Ausmaß erfüllt waren, zu den späteren Befragungszeitpunkten einen besseren Gesundheitszustand und eine bessere gesundheitsbezogene Lebensqualität berichteten. Dieses Ergebnis spricht für die Annahme, dass sich eine Behandlung, die den Präferenzen der Betroffenen entspricht, positiv auf die Gesundheit und Lebensqualität der Betroffenen auswirkt.
Im Herbst 2025 werden wir die Ergebnisse des Projekts Qualy-GAIN allen teilnehmenden Patient*innen, die daran Interesse haben, zusätzlich im Rahmen eines Online-Treffens präsentieren. Eine Einladung zu diesem Treffen erhalten Sie noch in einer gesonderten Mail.